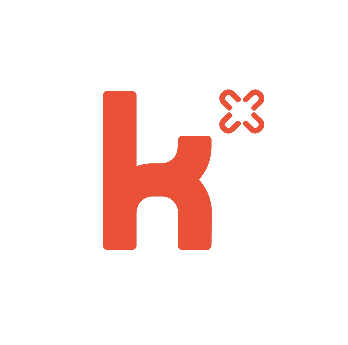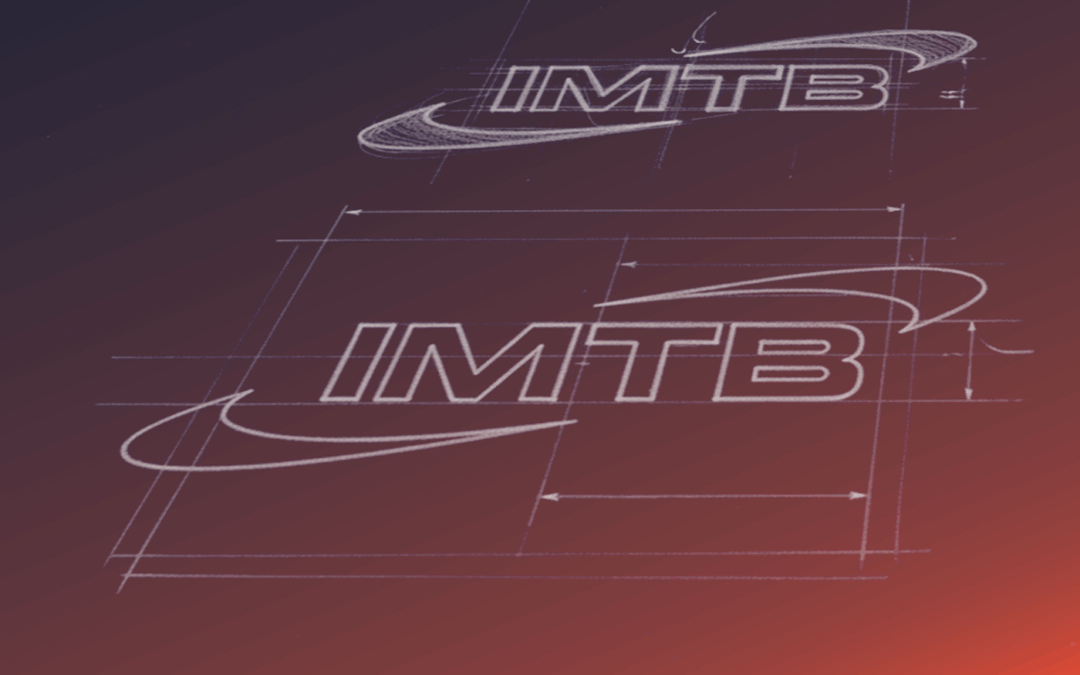Wir treffen unseren Kollegen Dr. Florian Gläser auf einen kleinen Spaziergang von unserem Kölner Büro zum Rhein. Unterwegs plaudern wir munter über Architektur der 50er und 60er Jahre, Kölner Stadtgeschichte und landen an der Bastei am Rheinufer.
Das ist der Überrest eines früher militärisch genutzten Turms, dessen Fundament man in den 1920er Jahren genutzt hat, um darauf ein Restaurant zu errichten. Man hat damals diesen schönen expressionistischen Aufsatz draufgesetzt. Im Krieg war das Bauwerk zerstört und ist danach nochmal aufgebaut worden. Das Ganze stammt vom berühmten Architekten Riphahn, der in Köln vor allem in den 50er Jahren viel gebaut hat. Die Bastei ist jetzt aber geschlossen, weil das Gebäude komplett sanierungsbedürftig ist.
Ich liebe es, wenn Leute so viel über ihre Stadt wissen ….
Das ist so ein bisschen mein Erbe, das sonst nicht mehr so zum Tragen kommt. Ich habe mal Geschichte und Kunstgeschichte studiert.
Du bist also auch einer von den IMTB-Kollegen, die nicht aus einer Fachrichtung stammen, die man gemeinhin erwarten würde.
Genau. Ich habe ganz breit angefangen: Geschichte, Politik, spanische Philologie und Philosophie. Eigentlich waren mein Schwerpunkte Geschichte und spanische Philologie. Und dann bin ich im dritten Semester Vater geworden und habe gedacht: Um Spanisch ernsthaft zu studieren, müsste man ein Jahr nach Spanien gehen. Das ging aber nicht, weil ich natürlich als Vater hier unverzichtbar war. Also bin ich geblieben und habe noch ein neues Zweitfach gebraucht. Das wurde Kunstgeschichte. Bei Geschichte war ich schon mit allen Scheinen durch und habe dann in drei Semestern alle Scheine fürs Nebenfach gemacht.
Bei Kunstgeschichte bin ich bis zur Doktorprüfung geblieben. In meiner Doktorprüfung waren – ergänzend zu meinem Schwerpunkt „Mittelalter“ im Hauptfach Geschichte – meine Schwerpunktthemen Gotik, mittelalterliche Buchmalerei und mittelalterliche Plastik. Du kannst mich also wenig zu moderner Kunst und auch wenig zu frühneuzeitlicher Kunst fragen.
Also hast du Geschichte und Kunstgeschichte abgeschlossen. Wie ging es nach dem Studium weiter?
Danach lief es für mich an der Uni erstmal super. Ich hatte früh einen Job als Wissenschaftliche Hilfskraft und nach der Magisterarbeit eine halbe Mitarbeiterstelle. Da konnte ich meine Dissertation schreiben und habe auch in der Lehre angefangen. Man denkt in dem Moment ja, dass es immer so weiter geht. Aber dann hat mein Doktorvater plötzlich seine Aktivitäten eingestellt und in so einem Uni-Betrieb ist man nun mal auf Gedeih und Verderb dem Doktorvater ausgeliefert.
Wenn man versucht, sich auf Mitarbeiterstellen an anderen Unis zu bewerben, haben die alle ihre eigenen Leute herangezogen. Man kommt da nicht rein. Es ist eine absolute Ausnahme, dass wirklich ernsthaft jemand von außerhalb gesucht wird.
Aber ich hatte an der Uni schon in einem DFG-Forschungsprojekt gearbeitet, bei dem ich viel in Archiven unterwegs war. Da habe ich mir gedacht: Das ist doch eigentlich ein interessantes Arbeitsfeld, bewirb dich doch mal für den Archivdienst. Und das habe ich dann gemacht. Es ist ein super enges Nadelöhr. Bundesweit werden ungefähr 20 Personen pro Jahr, verteilt auf die verschiedenen Landesarchivverwaltungen ausgebildet. Und für den höheren Archivdienst ist die Promotion Voraussetzung. Man absolviert da zunächst ein Referendariat und ich bin damals schon in großen Schritten auf die Altersgrenze von 32 Jahren zugeschritten. Im allerletzten Jahr, in dem das noch möglich gewesen ist, habe ich es dann geschafft.
Ich habe das Archivreferendariat zwei Jahre gemacht und anschließend ein paar Jahre als Archivar gearbeitet. Für die digitalen Themen in dem Berufsfeld habe ich mich damals schon interessiert. Die Archivare waren nämlich ganz früh am Thema „Digitale Archivierung“ dran. Zu einem Zeitpunkt, als die Verwaltungen noch weit weg waren von der E-Akte, haben die Archivare sich schon vorbereitet und sich gefragt: Was machen wir, wenn die Verwaltungen uns E-Akten abgeben?
Ich bin damals oft zu Veranstaltungen gefahren, z. B. zur Jahrestagung E-Akte und dort bin ich mit Herrn Ullrich von Infora ins Gespräch gekommen. Er hat irgendwann gesagt: „So jemanden wie Sie suchen wir; jemanden, der selber die Innensicht aus der öffentlichen Verwaltung hat, der sich mit diesen Themen schon beschäftigt hat und das ganze Thema Schriftgutverwaltung systematisch gelernt hat“. Es gibt ja keine Registraturausbildung in den Verwaltungen mehr. Die einzigen, die das systematisch curriculumbezogen lernen, sind die Archivare. Und da mein letzter Job als Archivar in einer Archiv-Beratungsstelle war, ich also Archive beraten hatte, kannte ich die Beratungstätigkeit und das projektbezogene Arbeiten. Der Schritt war eigentlich sehr klein.
Wenn man also denkt: „Wie wird man vom Mediävisten zum Unternehmensberater? Das ist doch ein Riesenschritt!“ Mit diesen Zwischenschritten ist es total plausibel.
Und schon warst Du mittendrin in der Beratungsbranche.
Ja, ich habe bei der Infora angefangen und gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich konnte mich mit meinem Fachwissen einbringen, denn ich war ja nicht so ein absoluter Neuling. Und ich habe vieles andere gelernt, Projektmanagement zum Beispiel. Das hatte ich vorher im öffentlichen Dienst nicht so systematisch gemacht.
Bei Infora lief es eine ganze Weile gut, aber ich bin dann doch weitergezogen, habe andere Erfahrungen gesammelt und 2019 zur IMTB gekommen. Gemessen an meinem Alter bin ich noch nicht so lange in der Beratung, erst seit 16 Jahren. Andere, die direkt nach ihrem Studium in die Beratung gegangen sind, sind länger dabei, aber jünger als ich.
Aber es ist eigentlich auch ganz schön, den Blick aus verschiedenen Richtungen zu haben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte am Anfang meiner Beratungskarriere relativ schnell große Projekte in mehreren katholischen Bistümern. Da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, je nach Kundenumfeld den richtigen Ton zu treffen und die richtige „Sprache“ zu sprechen. Und da ich in diesem Umfeld auch so ein bisschen sozialisiert bin, konnte ich also mit meinen Ansprechpartnern so reden, dass sie nicht dachten: „Was ist das denn für einer!“ Das waren teilweise große Projekte mit bis zu 450 Personentagen, bei denen wir die E-Akte mit allem Drum und Dran vorbereitet haben.
Kanntest Du die IMTB schon aus Projekten?
Ja, ich hatte schon mit einigen Kolleginnen und Kollegen in einem Projekt zusammengearbeitet. Ich fand es damals so schön zu sehen, wie sie miteinander umgegangen sind und dachte mir, dass es bestimmt nett ist, da zu arbeiten. Und dann habe ich einfach mal bei einem der Geschäftsführer, der auch in diesem Projektteam war, gefragt. Es hat dann noch etwas gedauert, weil sich die IMTB so einer Art unausgesprochener Vereinbarung verpflichtet gefühlt hatte, dass man nicht aus gemeinsamen Projekten die Leute abwirbt. Aber ich habe nicht lockergelassen und man ist sich dann einig geworden.
Als Du zur IMTB gekommen bist, warst Du ja einer von denjenigen, die bei uns die Rolle Team-Manager entwickelt und als erstes mit ausgefüllt haben.
Stimmt. Da war ich noch gar nicht so lange dabei. Ich habe im Juli 2019 angefangen und wir haben uns zum ersten Mal vor der Weihnachtsfeier in Dresden 2019 zusammengesetzt und Vorüberlegungen angestellt: Was will die Geschäftsführung eigentlich von der Rolle? Was können wir uns vorstellen? Wie gestalten wir das aus?
Wir mussten also klären: Was trägt eigentlich diese Rolle? Ist das eine Funktion oder ist das ein Status oder eine Kombination aus beidem? Und in welchem Verhältnis ist das eine Kombination? Das war wirklich ein Prozess und die Vorstellungen davon, was genau die Rolle ausmacht, haben zwischen uns und der Geschäftsführung nicht von Anfang an übereingestimmt.
Am Ende ging es dann um Unterstützung und Entlastung bei der Angebotserstellung. Und später kam noch das Thema Personalentwicklung hinzu. Das war am Anfang aus der Sicht der Geschäftsführung gar nicht so vordergründig Teil der Aufgabe. Wir Teammanagerinnen und Teammanager haben allerdings in diesem Punkt fast einen noch größeren Bedarf gesehen. Wir wurden ja als Firma immer größer und es wurde für die einzelnen Geschäftsführer schwieriger im Detail mitzubekommen, was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen bewegte.
Und Ihr habt das dann gemeinsam mit der Geschäftsführung erarbeitet?
Genau. Wir haben immer wieder Vorschläge entwickelt, uns Feedback abgeholt und immer wieder weiterentwickelt. Es sind dann Sachen herausgearbeitet worden, wie: Hat jeder Teammanager ein festes Team, ja oder nein? Wir haben entschieden, dass wir ein komplett festes Team eigentlich nicht wollen, weil so etwas dann schnell Abteilungscharakter bekommt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, in welchem Turnus wir die Teams neu zusammensetzen. Wir haben damals entschieden, dass die Teams jedes Jahr neu zusammengestellt werden. Aber da haben wir inzwischen nachgesteuert. Zuletzt haben wir gesagt, ein Jahr ist zu kurz, wenn wir Personalentwicklung machen wollen, also wechseln die Teams jetzt alle zwei Jahre.
Wir haben also immer daran weitergearbeitet. Mir persönlich macht das ganz großen Spaß, insbesondere das Thema Personalentwicklung.
Wenn du so in die Richtung Personalentwicklung denkst, was sind denn die Kompetenzen, die ausgebaut werden müssen? Was wird im öffentlichen Sektor für die Beratung gebraucht? Was brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen?
Das ist ganz vielfältig. Zunächst war da die Überlegung: Die IMTB-Belegschaft ist so gewachsen, dass die einzelne Person vielleicht gar nicht mehr so richtig gesehen wird. Am Anfang stand also diese ganz naive Idee, die Kolleginnen und Kollegen noch mal besser sichtbar zu machen. Also sich gesehen zu fühlen, wertgeschätzt zu fühlen und mit einem Anliegen auch wirklich durchzudringen; allein durch den Umstand, dass es nun vier, dann fünf weitere Personen gibt, auf die sich diese Aufgabe verteilt. Und aus der umgedrehten Perspektive: Näher dran zu sein an den Kolleginnen und Kollegen, über die Konstellationen hinaus, die das Projektstaffing an Teams hervorbringt. Das war der Grundgedanke. Und daraus hat sich alles entwickelt. Was brauchen die Kolleginnen und Kollegen denn eigentlich, um gesehen zu werden? Was brauchen sie, um gefördert zu werden? Die Teammanagerinnen und -manager nehmen sich dafür die Zeit in Einzelgesprächen und in Team-Jour Fixes. Und neben der Arbeit in den einzelnen Teams haben wir auch einen wöchentlichen einen Jour Fixe, um uns und unsere Aufgaben weiterzuentwickeln.
Wenn Du „gesehen werden“ sagst, fällt mir ein, dass wir beide uns des Öfteren über das Thema Diversität unterhalten haben. Du hattest uns auch ein Statement zum Coming-Out-Day gegeben und damals aufgefordert: „Kommt mal raus aus dem Schrank“. Also die Aufforderung sich sichtbar zu machen. Oft ist der Adressatenkreis ja genau umgekehrt gewählt. Ich fand es interessant, dass du es so rum formuliert hattest.
Es müssen ja immer beide Perspektiven gegeben sein in einer sozialen Interaktion: Eine Seite, die sich öffnen möchte, und eine Seite, die sich auf die Öffnung einlassen möchte.
Unsere Branche ist eindeutig männerlastig, bei der IMTB nicht so extrem, aber doch auch. Bei anderen Unternehmen in der Branche ist das noch viel stärker ausgeprägt und bei manchen auch auf eine ganz unangenehme Art. Ich weiß, dass der Begriff toxische Männlichkeit überstrapaziert ist, aber er lässt sich darauf schon anwenden. Da wird kokettiert mit endlosen Überstunden, wie tough man im Umgang mit sich selbst ist und wie man sich dann wieder mit irgendwelchen Extremsportarten seinen Ausgleich verschafft. Abweichende Einstellungen finden wenig Bestätigung oder Akzeptanz.
In einem solchen Branchen-Umfeld ist es als schwuler Mann noch mal schwieriger zu sagen: Ich adaptiere das Bild nicht für mich. Was vielleicht aber auch nur bedingt was mit der Homosexualität zu tun hat, denn es gibt natürlich schwule Männer, die das genauso leben und das genauso für sich adaptieren. Aber worauf ich hinauswill, ist, dass vielleicht die Sorge größer ist in so einem Umfeld zu sagen, ich spiele das nicht mit, als in einem anderen Umfeld. Wenn ich Make-up-Artist am Theater bin, habe ich die Probleme wahrscheinlich nicht.
Ich finde es einfach wichtig, dass es in einem Unternehmen eine Atmosphäre gibt, wo man das gar nicht groß und plakativ thematisieren muss. Auf der anderen Seite soll es eben auch überhaupt gar kein Problem sein, dass ich, wenn alle von ihrem Urlaub erzählen, dann eben auch sagen kann: Ich war mit meinem Mann im Urlaub.
Ich habe im beruflichen Kontext nie eine direkte Diskriminierung erfahren, aber man nimmt eben auch viel „Angriffsfläche“ vorweg. Also aus einer Vorsicht heraus.
Aber Diversität ist ja viel breiter! Im Diversity Management geht es darum, dafür zu sensibilisieren, dass die Menschen in einem Team sehr unterschiedlich sein können: ethnisch, kulturell, bezüglich ihrer Persönlichkeitsmerkmale oder eben auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Manche dieser Eigenschaften sind irrelevant für unsere Arbeit, andere prägen hingegen unsere Erfahrungen sehr stark und damit die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, Situationen einschätzen oder Lösungsansätze entwickeln. Und darin liegt das Potential: Diese Unterschiedlichkeit bei den anderen im Team sehen zu wollen und einbinden zu können und – im besten Fall konstruktiv und kreativ – in die Arbeit einfließen zu lassen.
Vor zwei Jahren haben wir uns das erste Mal über das Thema Diversity ausgetauscht. Damals ging es unter anderem darum, ob man Symbole und Zeichen auf der Website verwenden sollte. Du hattest damals darauf hingewiesen, dass diese Zeichen für diejenigen, die homosexuell oder queer sind, signalisieren, dass man willkommen ist und in der Firma offen damit umgehen kann.
Genau. Natürlich gibt es „Pinkwashing“, also die Selbstdarstellung als „queerfriendly“ als reine PR-Maßnahme. Irgendwo eine Regenbogenfahne in die Ecke der Website zu klatschen, da ist noch nichts darüber gesagt, wie einem Kolleginnen und Kollegen tatsächlich begegnen werden. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt. Dennoch ist es ein erstes kleines Signal, das Betroffenen, die sich überlegen, zu uns ins Team zu kommen, nicht entgehen wird.
Lieber Florian, vielen Dank Dir für das interessante und offene Gespräch. Ich würde zu gerne mal mit Dir in eine Ausstellung über mittelalterliche Buchmalerei gehen.